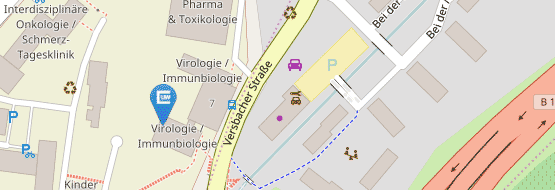Arbeitsgebiete
Aktivierung und Evolution der Vγ9Vδ2 T-Zellen und die physiologische Bedeutung der Butyrophiline
Die meisten T-Zellen (konventionelle T-Zellen) nutzen ihren T-Zell-Antigen-Rezeptor (TCR), um Komplexe aus (fremden) Peptiden und körpereigenen Zelloberflächenmolekülen, den MHC-Klasse-I- und -II-Molekülen, zu erkennen. Wie auch die meisten der antikörperproduzierenden B-Zellen sind sie Teil des adaptiven Immunsystems. Die nicht-konventionellen T-Zellen hingegen schlagen eine Brücke zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Ihre TCRs erkennen keine erregerspezifischen Antigene, sondern krankheitsassoziierte molekulare Muster. Wir erforschen die Mechanismen dieser Antigenerkennung, ihre Evolution und die Aktivierung solcher Zellen.
Zu den nicht-konventionellen T-Zellen gehören bestimmte Gruppen von T-Zellen, die wie "konventionelle" T-Zellen ein αβTCR tragen: z.B. MAIT-Zellen und iNKT-Zellen. Diese erkennen keine Peptid-MHC-Komplexe, sondern Komplexe aus (Glyko-)Lipiden oder Folsäuremetaboliten und MHC-Klasse-I-ähnlichen Molekülen (MR1 oder CD1d). Andere nicht-konventionelle T-Zellen sind die γδ-T-Zellen, die phylogenetisch das gleiche Alter wie B-Zellen oder αβ-T-Zellen haben und in fast allen Kieferwirbeltieren vorkommen.
Eine Besonderheit vieler nicht-konventioneller T-Zellen ist, dass die Nutzung bestimmter TCR-V-Regionen mit deren Zellfunktion und Lokalisation korreliert. Sie werden daher oft nach den Genen benannt, die diese TCRs kodieren, wie z.B. die Vγ9Vδ2-T-Zellen, deren TCR Vγ9- und Vδ2-Gen-kodierte V-Regionen besitzen. Sie stehen im Mittelpunkt unserer aktuellen Studien.
Evolution und Antigenerkennung
1-5% der T-Zellen im Blut exprimieren einen Vγ9Vδ2 TCR. Diese T-Zell-Antigenrezeptoren erkennen sogenannte Phosphoantigene, die phosphorylierte Metaboliten der Isoprenoidsynthese sind. Vγ9Vδ2 T-Zellen eliminieren Tumorzellen und expandieren bis zu 50% der Blut-T-Zellen zu Infektionen mit Krankheitserregern, die das Phosphoantigen HMBPP produzieren. Wichtige HMBPP-produzierende Erreger sind z.B. Plasmodium-Spezies (Malariaerreger) oder Mykobakterien (Erreger von Tuberkulose und Lepra). Vor fast zehn Jahren haben wir gezeigt, dass neben dem BTN3A1-Gen auch andere Gene auf dem menschlichen Chromosom 6 für die Phosphoantigen-vermittelte Aktivierung essentiell sind. In jüngerer Zeit haben wir BTN2A1 als das entscheidende Gen identifiziert und in Zusammenarbeit mit der Willcox-Gruppe (Birmingham, UK) die direkte Bindung des BTN2A1-Proteins an Vγ9-kodierte Regionen des Vγ9Vδ2 TCR nachgewiesen. (Pressemitteilung)
Die Vγ9Vδ2 T-Zellen kommen in Nagetieren nicht vor. Daher gibt es kein Kleintiermodell für deren Analyse. Wir konnten allerdings zeigen, dass auch nicht Primatenspezies Vγ9Vδ2 TCR und BTN3A Gene besitzen und im Alpaka PAg-reaktive Zellen direkt nachweisen, die interessante Ähnlichkeiten mit dem menschlichen System der Phosphoantigenantwort aufweisen. Der Vergleich von BTNs und TCR beider Spezies war schließlich entscheidend für unsere kürzlich veröffentlichte Studie, in der wir modifizierte BTN3-Gene in BTN3-defizienten Zellen exprimierten. Diese Zellen wurden dann auf verschiedene Merkmale wie die Fähigkeit, Phosphoantigene zu "präsentieren", die Lokalisation der BTN3-Konsukte in der in der Zelle, biochemische Eigenschaften und Bildung von Oligomeren analysiert und schließlich auch deren Interaktion mit dem BTN2A1-Molekül. Aus diesen Ergebnissen haben wir ein neues Modell für die Interaktion der BTN-Moleküle in der Phosphoantigenantwort entwickelt (Pressemitteilung).
Fortgesetzt werden die Analysen des Mechanismus der BTN3A1-vermittelten Vγ9Vδ2 T-Zellaktivierung und der Wirkung von Modulatoren der Isoprenoidsynthese wie klinisch applizierten Aminobisphosphonaten, die der Entwicklung einer Vγ9Vδ2 T-Zell-basierten Tumortherapie dienen. Als neues Arbeitsgebiet wurde die Modulation der Immunantwort durch BTN(3)-Moleküle erschlossen wofür wir unsere Erfahrung in der Analyse der molekularen Grundlagen von Phosphoantigenen nutzen. Trillium Artikel 2021